
Nur mit mehr Arbeit ist Deutschlands Wirtschaftsmisere zu überwinden
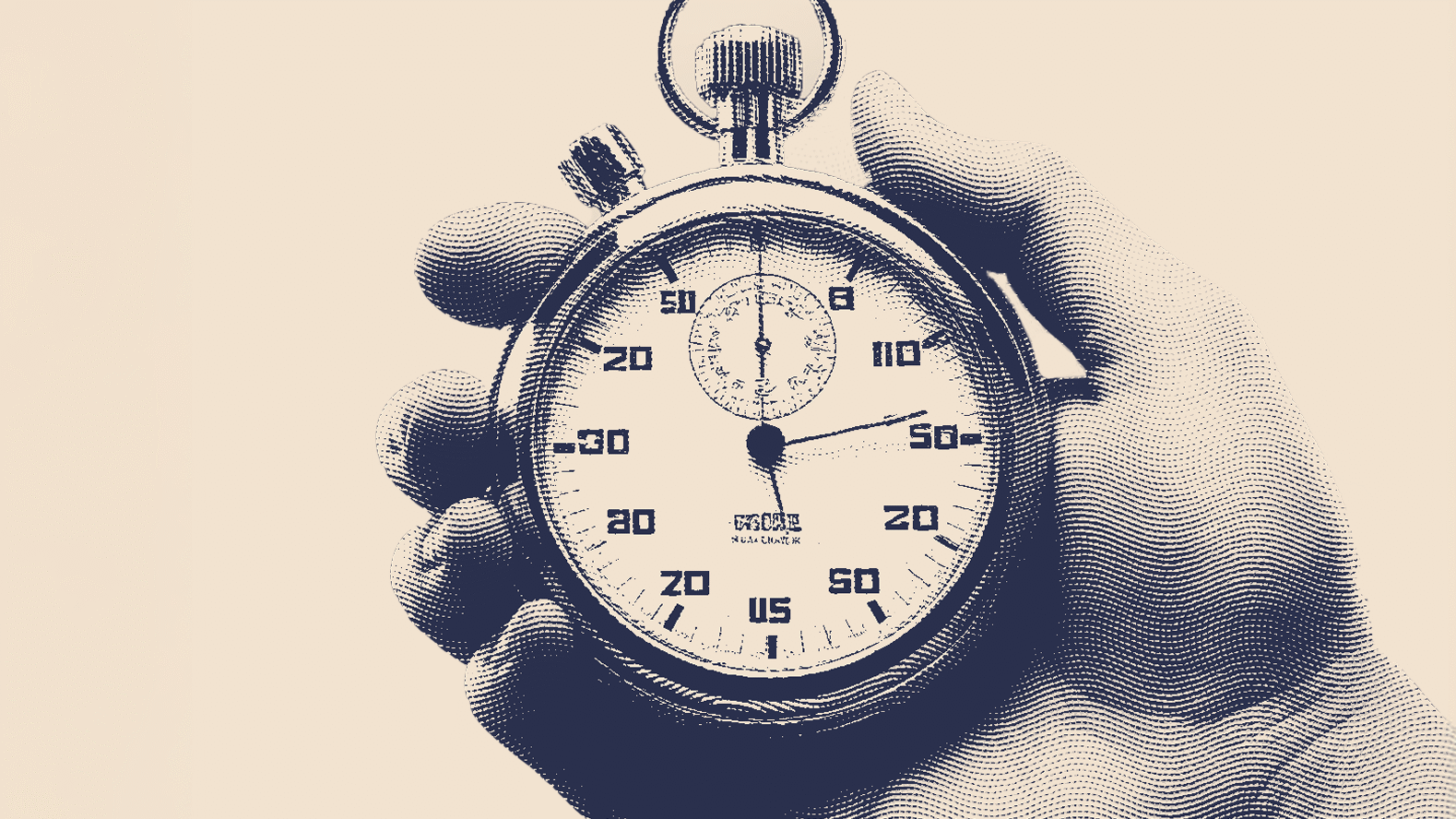
Die Wirtschaftsleistung der Zukunft hängt an einem altmodischen Hebel: der Arbeit. Ohne zusätzliche Beschäftigte, längere Wochenstunden und bessere Vollzeit-Anreize dürfte das deutsche Wachstum weiter lahmen. Das Problem: Den Arbeitseinsatz zu steigern verlangt nicht weniger als eine wirtschaftspolitische Kehrtwende – und die Zeit dafür wird knapp.
Der Wachstumstrend der deutschen Wirtschaft ist seit Jahrzehnten rückläufig. Aktuelle Berechnungen wie die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute zeigen, dass das um Konjunkturschwankungen bereinigte und mittelfristig erzielbare Wachstum in den kommenden Jahren bis 2030 im Schnitt gerade einmal bei 0,3 % p.a. liegen wird.
Das hätte Folgen: Gelingt es nicht, diese Rate des sogenannten Potentialwachstums zu erhöhen, kommt es zu weiteren Ausfällen bei Steuereinnahmen und Sozialbeiträgen, und es werden angesichts der nötigen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung harte Einschnitte bei anderen Ausgabekategorien nötig sein.
Das richtige Ziel hat sich die Regierung schon mal gesetzt
Um aus diesem 0,3-Prozent-Dilemma zu kommen, ist es richtig, dass sich die Regierung zum Ziel gesetzt hat, das mittelfristige Wachstum zu erhöhen. Im Koalitionsvertrag ist zwar keine genaue Zahl genannt, aber im Umfeld der Verhandlungen war von verschiedenen Seiten von 1 % bis zum Ende des Jahrzehnts die Rede. Zugegeben, ein solches Ziel erscheint zahlenmäßig nicht besonders beeindruckend. Tatsächlich aber setzt es nicht weniger als eine Trendwende bei der Entwicklung des Arbeitsvolumens und der Investitionstätigkeit voraus.
Deutlich wird das, wenn man sich die Treiber des Wachstums anschaut: Arbeit, Kapital und technologischer Fortschritt. Bei der Entwicklung des trendmäßigen Arbeitsvolumens in Deutschland wird bei den gängigen Berechnungen mit einem mehr oder weniger starken Rückgang bis zum Jahr 2030 gerechnet. Der „Produktionsfaktor Arbeit“ steht also eher für negatives Wachstum. Berechnungen mit der modifizierten EU-Methode zeigen einen negativen Beitrag des Arbeitsvolumens zum Potenzialwachstum von durchschnittlich -0,2 % pro Jahr.
Was der Renteneintritt der Baby-Boomer bedeutet
Dahinter steht die Annahme, dass die Erwerbsbevölkerung von rund 63 Millionen Personen in den kommenden Jahren, auch aufgrund des Renteneintritts vieler „Baby-Boomer“, leicht zurückgeht. Die vielen Renteneintritte führen auch dazu, dass die Erwerbsbeteiligung, also die Zahl derjenigen im erwerbsfähigen Alter, die dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen, im Trend kaum noch steigt.
Wenn es nicht gelingt, die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen und die Arbeitslosenquote deutlich zu reduzieren, kann eine Trendwende bei der Arbeitszeit nur über eine zunehmende Anzahl an Arbeitsstunden pro Erwerbstätigen erzielt werden. Die jährliche Arbeitszeit pro Erwerbstätigen geht in Deutschland seit vielen Dekaden im Trend zurück und sie liegt mit etwa 1340 Stunden weit unter der in anderen Ländern (zum Vergleich: USA 1680 Stunden). Darin spiegelt sich in der langen Frist eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit und ein deutlich steigender Anteil an Teilzeitbeschäftigung insbesondere bei Frauen.
Wie kann eine Trendwende bei der Arbeitszeit gelingen?
Grundsätzlich gibt es mehrere Stellschrauben für die Wirtschaftspolitik. Wichtig wäre es zunächst, die Erwerbstätigkeit älterer Menschen und von Bürgergeldempfängern zu erhöhen – dazu sollen Instrumente wie die Aktivrente und die verstärkten Meldepflichten von Bürgergeldempfängern bei den Job-Centern dienen. Ob diese Maßnahmen allein einen stärkeren Effekt haben, ist allerdings fraglich.
Ansatzpunkte gibt es auch bei der durchschnittlichen Arbeitszeit. Möglich wären längere Wochenarbeitszeiten. Ein wichtiger Hebel ist auch die Verbesserung der Anreize für ein Vollzeitbeschäftigung insbesondere von Frauen. In mittleren Einkommensgruppen ist der Wechsel oft finanziell nicht interessant, weil die Steuerprogression den Einkommenszuwachs mindert und soziale Leistungen wegfallen. Auch das Thema der Kinderbetreuung ist für mehr Vollzeittätigkeiten in Deutschland wichtig.
Neben einer Erhöhung des Arbeitsangebots ist auch eine Steigerung der Arbeitsnachfrage erforderlich. Es sind zwar noch sehr viele offene Stellen nicht besetzt – allein die amtlich gemeldeten Vakanzen liegen bei 660.000 gemeldeten offenen Stellen. Langfristig ist es jedoch für Wachstum nötig, die Nachfrage nach Arbeitsleistung in den Unternehmen zu erhöhen. Dazu wiederum sind bessere Rahmenbedingungen nötig, ansonsten wird der massive Abbau der Beschäftigung, der vor allem in der Industrie stattfindet, fortgesetzt werden.
Und wenn die Trendwende nicht gelingt?
Die Erhöhung des Arbeitsvolumens ist der zentrale Faktor für mehr Wachstum in den kommenden Jahren. Wenn es nicht gelingt, den trendmäßigen Rückgang des Arbeitsvolumens in Deutschland zu stoppen, wird es auch nicht gelingen, das mittelfristige Wachstum wieder auf 1 % anzuheben. Es ist zwar möglich, über bessere Rahmenbedingungen für Investitionen und Strukturreformen den Aufbau des Kapitalstocks zu fördern, aber hierbei handelt es sich um längerfristige Prozesse.
Maßnahmen wie Abschreibungserleichterungen und erhöhte staatliche Infrastrukturausgaben zielen auf die Steigerung privater Investitionen ab. Aber selbst, wenn sie erfolgreich sind, wird durch Investitionen die Produktivkraft und das Wachstum des Kapitalstocks nur relativ langsam verbessert: In den Projektionen der Institute wird ein Ende des Investitionsrückgangs und eine leichter Anstieg der Investitionen unterstellt. Dennoch wird der Beitrag des Faktors Kapital zum Produktionsergebnis kaum steigen. Es braucht eben viele Jahre höherer Investitionen, um den volkswirtschaftlichen Kapitalstock wieder deutlich schneller wachsen zu lassen. An einer Ausweitung des gesamten Arbeitsstundenvolumens geht also auch aus diesem Betrachtungswinkel kein Weg vorbei.
Kann der technische Fortschritt helfen?
Viele setzen ihre Hoffnungen in die Wachstumswirkungen des technischen Fortschritts, ein wichtiger Themenbereich, zu dem vor kurzem Nobelpreise für bedeutende Forschungen verliehen wurden. Und dennoch: In den Projektionen des Wachstumspotentials der deutschen Wirtschaft wird der technische Fortschritt, der bei gegebenem Arbeits- und Kapitaleinsatz die Produktion und Einkommen erhöht, mit einem Wachstumsbeitrag von durchschnittlich gerade einmal 0,2 % p.a. ermittelt.
Sicherlich lässt sich dieser Beitrag mittelfristig deutlich steigern, aber kurzfristig sind die Möglichkeiten der Politik begrenzt. Mehr Digitalisierung, gezielte Forschungsförderung oder bessere Finanzierungsbedingungen für innovative Start-Ups sind alles wichtige Voraussetzungen für eine hohe Innovationstätigkeit, aber keine einfachen und schnell wirksamen Hebel der Politik.
Fazit: Der „Herbst der Reformen“ sollte nicht verpuffen
Das ernüchternde Fazit zahlreicher Analysen lautet, dass bis zum Ende des Jahrzehnts kaum Aussicht auf höheres Trendwachstum besteht. In den Zahlen der Gemeinschaftsdiagnose wird das Produktionspotential in den Jahren bis 2030 jahresdurchschnittlich lediglich um 0,3 % zunehmen. Die kurzfristig nicht leicht veränderbaren Beiträge des Faktors Kapital (0,3%) und des technischen Fortschritts (0,2%) tragen zum Wachstum bei, während das Arbeitsvolumen sich negativ entwickelt und damit zu einem Produktionsrückgang (-0,2%) beiträgt. Hier ist eine Trendwende erforderlich, wenn die Bundesregierung in absehbarer Zeit auf einen Potentialzuwachs von 1 % kommen möchte.
Ansatzpunkte gibt es viele: Bessere Beschäftigungsbedingungen für die Unternehmen, mehr Erwerbsbeteiligung von Älteren (Rentenpolitik und Steuerpolitik) und von Bürgergeldempfängern (Sozialpolitik und Beschäftigungspolitik) und weniger Teilzeitbeschäftigte (Steuer- und Sozialpolitik, Kita- und andere Betreuungsangebote für Familien) wären verhältnismäßig schnell wirksame Maßnahmen. Daher wäre es bedeutsam, dass aus dem Herbst der Reformen doch noch etwas Substantielles rauskommt.